Der Begriff Cyberpunk kommt im Text von Remember Tomorrow an vier Stellen vor, einmal für Pondsmiths Rollenspiel als Einfluss und im Nachwort. Dort erklärt Hutton, er habe das Spiel in erster Linie für sich selbst geschrieben als Toolkit und Framework für Rollenspiel in den near-future Welten William Gibsons und anderer Cyberpunk-Klassiker (
Hardwired,
Vurt,
Fairyland). Das wird auf dem Einband wiederholt. Im Titel fehlt Cyberpunk stattdessen heißt es Remember Tomorrow Near Future Role-Playing und near-future "cyberpunk" game im Klappentext. Dass sich das Spiel einerseits unmittelbar auf die literarischen Ursprünge beruft und sich andererseits als Cyberpunk in Anführungszeichen präsentiert, zeigt,
dass für Cyberpunk-Rollenspiele ganz andere Erwartungen gelten. Hutton selbst identifiziert sie im Nachwort: Team- bzw. missionsbasiertes Spiel mit kleinteiligen Regeln für Waffen und Ausrüstung. Dieses Prinzip hat
Shadowrun aus Pondsmiths
Cyberpunk isoliert und so fest als eigenes Genre verankert, dass ein PbtA-Spiel wie
The Sprawl es heute emulieren kann. Davon grenzt sich RT ähnlich strikt ab wie andere moderne Cyberpunkrollenspiele, z.B.
The Veil (persönliche und philosophische Fragen im Mittelpunkt) oder
SYNC (gewaltfrei). Dazu kommt, dass mit Paul Haggis'
Crash (2004) ein Film auf der Liste der Einflüsse steht, der nichts mit Cyberpunk zu tun hat.
/pic514946.jpg) |
| Stilbildend: Shadowrun 1E (1989) |
|
Was RT nicht nur von Cyberpunk- sondern den meisten Rollenspielen unterscheidet: Die Hauptfiguren beginnen das Spiel ohne jede Verbindung zueinander und mit völlig unterschiedlichen Zielen, die sie im Spielverlauf zu erreichen versuchen. Kein Team, keine Mission. Berührungspunkte sind zufällige, sogenannte Crosses, durch die eine Szene in die darauffolgende überschwappt, die Fraktionen - mehr über Deals denn als gemeinsamer Feind - und die Möglichkeit zu Face Off-Szenen zwischen Hauptfiguren.
Wie ihre literarischen Vorbilder tendieren Hauptfiguren in RT zur Einsamkeit. Connected, Supported, Loved sind Conditions, temporäre Zustände, die sie durchlaufen und daran festzuhalten, ist schwer. Außerdem kann jede Hauptfigur am Ende der eigenen Szene durch eine beliebige andere Figur ersetzt werden, die daraufhin ihren Platz einnimmt. Langfristig passiert dasselbe aufgrund der Episodenstruktur. Die Welt aus vielen Blickwinkeln zu erspielen, ahmt die konventionelle literarische Technik paralleler Handlungsstränge nach, die Gibson z.B. in
Count Zero und
Mona Lisa Overdrive einsetzt. Also nichts, das Cyberpunk im Speziellen auszeichnet, aber in Verbindung mit dem Episodenhaften doch sehr spezifisch. Die Vorlage ist Molly Millions/Sally Shears in der Sprawl-Trilogie - Hutton spricht von Ausschnitten aus ihrem Leben, die wir zu lesen bekommen [Wenn ich im Folgenden auf Aussagen von ihm verweise, stammen die aus diesem Post:
http://www.indie-rpgs.com/forge/index.php?topic=31877.msg288018#msg288018 sofern nicht anders angegeben]. Bei Crash wiederum ist zunächst festzustellen, was RT nicht übernimmt: Haggis orchestriert die Verbindungen zwischen seinen Hauptfiguren akribisch, um eine fragwürdige Moral über Rassismus in den USA zu erzählen. Eine oder mehrere Episoden RT so zu ordnen, erscheint dagegen unmöglich.
Oder doch nicht? Es gibt in RT keinen Grund für die Figuren, zusammenzufinden, im Gegenteil schaden sie sich oft. Das kompetitive Element des Spiels habe ich in einem vorigen Beitrag ja bereits erwähnt. Beispielhaft machte sich das bereits in der ersten RT Runde, die ich gespielt habe, bemerkbar: Eine Personenschützerin läuft auf der Flucht vor der Yakuza einem Kurierfahrer in die Arme, der sie eine Weile in seiner Wohnung versteckt. Die beiden werden dort entdeckt, im darauffolgenden Chaos getrennt, der Kurier bekommt später im Rahmen seiner Tätigkeit für eine Informationsagentur die Möglichkeit, die flüchtige Bekannte ausfindig zu machen, was er zum Schluss nutzt, um ihren momentanen Aufenthaltsort, eine Klinik im Untergrund, an ihre Feinde zu verkaufen. Er bekommt seinen Exit. Was mit ihr passiert, finden wir nie heraus. Ist das also das Thema, unter dem Figuren in RT zusammenkommen? Brutaler Wettbewerb? Wer den Cyberpunk Gibsons oder Walter Jon Williams' als politisch perspektivlos kritisiert, kann dieselbe Kritik hier anbringen.
Die Figuren in RT erreichen die Ziellinie allein, haben sich durchgebissen, waren mehr Ready, mehr Willing und mehr Able als Andere. Das System - sowohl im Regel-Sinn als auch im Sinne der politischen Ordnung der Spielwelt - zu durchbrechen, macht RT den Spielenden sehr schwer. Die Zerschlagung von Fraktionen oder der Verzicht auf Deals sind spielmechanisch nachteilig. Hutton entgegnet, RT werfe gerade die Frage auf, wann und wie "the 80s thing", der rücksichtlose Opportunismus, zu überwinden sei.
Es fällt aber auf, dass sich, obwohl die Mechanik zum Beispiel bei den Exits Figuren gegeneinander ausspielt, das Spiel selbst gar nicht so kompetitiv anfühlt. Der wichtigste Grund dafür dürfte sein, dass Hutton an einer entscheidenden Stelle freiwillige Kollaboration zur Grundbedingung für einen erfolgreichen Ablauf macht: Wer in anderen szenenbasierten Rollenspielen wie
Fiasco an der Reihe ist, legt gewöhnlich eine Szene für die eigene Figur vor oder bekommt sie von anderen vorgelegt. RT dreht das für Konfliktszenen um, d.h. wer dran ist, legt ein Face Off für eine beliebige andere Hauptfigur, nie die eigene, vor. RT fragt also regelmäßig: Welche Figur, die du nicht selbst steuerst, möchtest du gerne in Bewegung und möglicherweise auch auf dem Weg zu ihrem Ziel sehen. Dieses Investieren in interessante Figuren statt gewinnorientiert in die eigene macht in RT einen abgerissenen Handlungsstrang, eine Figur im Streiflicht genauso essentiell wie erreichte Ziele.
Nicht der Wettbewerb beherrscht das Spiel, sondern das Transitorische: Vielleicht ist ihre scheinbar erfolglose Flucht das einzige, was wir in der Episode von einer Figur sehen, während einer anderen ihr Schlag gegen die Führungsebene einer einflussreichen Fraktion gelingt. In deren Machenschaften dann in Folgeepisode gleich mehrere ganz neue Figuren verwickelt werden. Wenn uns die postmoderne Stadt in der Literatur als "palimpsest of histories and narratives" [Bentley, Nick: Postmodern Cities, in: The Cambridge Companion to the City in Literature, hrsg. von Kevin R. McNamara, New York 2014, S. 176.] begegnet, dann lässt sich dasselbe über Somewhere sagen. Die Stadt, zwanzig Minuten in der Zukunft, ist in Remember Tomorrow weniger die klassische urbane Dystopie anderer Cyberpunkrollenspiele, weniger Night City, sondern genauso ambivalent und heterogen wie die Figuren und Fraktionen, die wir spielen. Wie heterogen ist das aber wirklich?
 |
| Die RT-Kampagne als Palimpsest? |
Von
Apocalypse World sind wir gewohnt, dass uns das Genre in Form von Prinzipien auf dem Silbertablett präsentiert wird. Remember Tomorrow macht das ebenfalls - sicher inspiriert von AW. Das erste Prinzip, Somewhere, die Stadt, ist, wie oben gezeigt, tief in der Spielmechanik verankert. Nummer Zwei verrät uns unter dem etwas kryptischen Titel Hotels|Airports mehr über die Menschen in Somewhere. Wen spielen wir also? In der Danksagung zu Beginn des Buches erwähnt Gregor Hutton eine Unterhaltung mit Joe Prince in der Abflughalle des Flughafens Helsinki und ich erinnere mich vage an ein Interview, in dem er sagt, dass ihm die Idee zu RT dort, am Flughafen, gekommen sei. Vielleicht denke ich da aber auch an dieses Stück Rollenspielweisheit:
https://www.youtube.com/watch?v=a-M-FgXf3zA. Was der Flughafen meint ist: Die Leute in der Welt von RT sind immer in Bewegung, immer irgendwohin unterwegs. In Autos, Zügen, Flugzeugen (auf dem Cover ist die Langzeitbelichtung einer Straße oder Trasse zu sehen). Wer ein Zuhause hat, ist dort nicht sicher, andere wohnen in Hotels. Als literarischer Gewährsmann dient RT Walter Jon Williams, den Hutton an dieser Stelle direkt zitiert. Aus "Motion is our most important product" wie es in der
Hardwired-Erweiterung für
Cyberpunk heißt, wird "Put your people in motion. It’s our most important product today." Der Inbegriff dieses Mottos ist in
Hardwired die Figur des Panzerboys, eines futuristischen "last American hero to whom speed means freedom of the soul" [Vanishing Point (1971)]. Auch hier muss sich RT der Kritik an den Cyberpunk-Klassikern der 80er stellen, die es sich so bereitwillig zum Vorbild nimmt. Seien es Cowboy-Machismo [Nixon, Nicola: Cyberpunk: Preparing the Ground for Revolution or Keeping the Boys Satisfied? URL:
https://www.depauw.edu/sfs/backissues/57/nixon57art.htm] oder Jetset-Elitismus (RT gleicht in seinen Prinzipien teilweise verbatim Suvins idealer Cyberpunk-Leserschaft: "it's not difficult to find the ideal reader of cyberpunk: [...] jet-setters who don't care whether they work in Tokyo, London, Düsseldorf, or Los Angeles—they just want to have their machines, they want to be part of a global network. [...] Their position is very strange. They despise the bureaucracy, they don't want to be mass people or peons (proletarians: that's a recurring nightmare in Gibson), they want fun, they want sex, they want to travel around the world. And yet they live off the despised bureaucracy." [Pukallus, Horst: An Interview with Darko Suvin: Science Fiction and History, Cyberpunk, Russia.... URL:
https://www.depauw.edu/sfs/interviews/suvin54.htm]). Äußerst negativ ist dahingehend zu bewerten, dass es um die Vielfalt im Text von RT schlecht bestellt ist:
In den Beispielen im Buch kommen 20 Männer und sechs Frauen vor, eine der Frauen ist ein Sexbot und wird am Ende enthauptet, eine weitere wird als Kellnerin von ihrem Drogenhändler-Boss misshandelt. Dass RT mit der Linse des Teams bricht, die in Cyberpunk und Shadowrun Unterschiede nivelliert, heißt also nicht, dass die Figuren nicht trotzdem in eine Richtung neigen können. Individualismus ist wie besprochen regelbedingt eine Tendenz. Die Rollen ("Identities") entsprechen denen aus Pondsmiths
Cyberpunk und können in Verbindung mit den Motivationen sehr unterschiedlich ausfallen. Erwähnenswert ist, dass RT Worker als zehnte Option hinzufügt. Da wäre also eine Identität, der das Privileg Mobilität unter Umständen nicht im gleichen Maße zukommt. Etwas, das laut Text ungewöhnlich ist und das ich in der Praxis noch nicht erlebt habe, ist, dass als Hauptfigur nicht eine Einzelperson, sondern eine Gruppe gespielt wird. Natürlich, und da gibt RT dem
Hardwired-Zitat einen Twist, der mir gefällt, bezieht sich die Bewegung hier auch auf die Dynamik des Spiels selbst: Die Figuren werden von einer Condition in die nächste geworfen und fühlen das auch - teilweise sind die Zustände ja auch emotionaler Natur. "Put your people in motion" heißt in dieser Lesart: Lass deine Figur ihren Zustand fühlen.
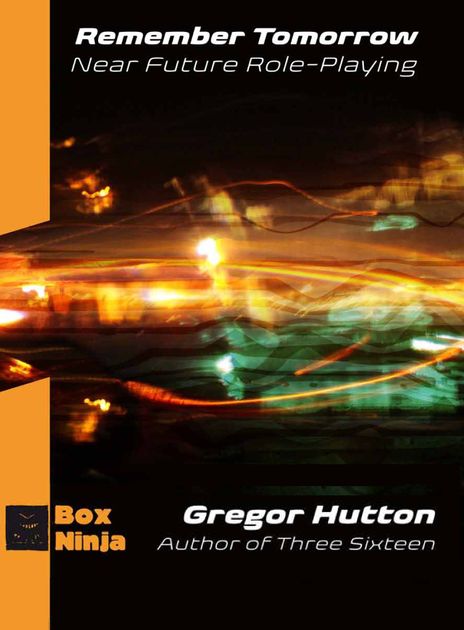 |
| In Bewegung: Remember Tomorrow (2010) |
Prinzip Nummer Drei: Fashion|Weapons. Allgegenwärtige Reklame und Branding. Verpass jedem Stück Ausrüstung ein Label. Die entsprechenden Namen finden sich am Ende des Buchs. Damit will RT das Chromebook-Gefühl evozieren. Dass man sich für die Marken an derselben Motivationstabelle bedienen soll wie für seine Figur, lässt einen leichten Zynismus durchdringen. Ansonsten ist das wie Hutton sagt nur coole Farbe. Ein bisschen mehr Dissonanz könnte es bringen, wenn die Fraktionen von derselben Liste erstellt würden.
Die nehmen nämlich in RT - und da sind wieder beim Kern der Sache - im Gegensatz zu anderen Cyberpunkrollenspielen nicht nur den Figuren, sondern auch den Spielenden die Handlungsfreiheit. Zu den eigenen Bedingungen dürfen sie nur dann handeln, wenn sie einen Deal mit einer Fraktion machen, der beide Seiten stärkt oder sich untereinander, d.h. andere Hauptfiguren, angreifen. Wer in RT eine Szene für die eigene Figur vorlegen möchte, ist also mechanisch gezwungen, den Fraktionen zuzuarbeiten. Face Off-Szenen werden wie gesagt von Mitspielenden initiiert, nie von der Person, die gerade am Zug ist. Es sind immer die Fraktionen, die sich, unter der Kontrolle eines Gegenübers am Tisch, in das Leben der Hauptfiguren einmischen, versuchen sie von ihrem Weg abzubringen, sie an den Rand zu drängen. In
The Sprawl ticken im Hintergrund Corporate Clocks, bei 00:00 fällt der Hammer der Megakonzerne.
In RT steht die Uhr immer auf 0. Kontrollverlust als ein Thema im Cyberpunk, das Gefangensein im System, sowie die peripheren Hauptfiguren von, z.B.,
Mona Lisa Overdrive adaptiert RT damit äußerst clever.
Prinzip Nummer Vier: Sex|Sexuality. Schon im
Cyberpunk-Lifepath ein Thema, hier allerdings deutlich heruntergefahren im Ton. Die von RT angebotenen Love Complications passen perfekt in einen generischen Film Noir und werden weder der "wild side", auf der sich die Figuren angeblich befinden noch unserer Gegenwart (von zwanzig Minuten in der Zukunft ganz zu schweigen) gerecht. Dazu kommen Dolls, Sexbots benannt nach Fairyland. Klischee. Ich arbeite an einer d10-Tabelle mit interessanteren Bots.
Prinzip Nummer Fünf: We're All Foreign Here|Currency. Es geht um die Straßenszenen aus Blade Runner und das Babel-Trope. Auch hier: Wie wäre es mit d10 merkwürdigen Sprachen gewesen, oder so? "You’re all foreign here. Get over it" klingt außerdem ein bisschen nach Crash und: Warum können wir uns nicht alle vertragen!?. Da das Prinzip mechanisch überhaupt nicht abgestützt wird, liegt das aber ohnehin bei der Gruppe. Dass ein ganzer Absatz auf die Frage nach der Währung verschwendet wird, obwohl sie weder abstrakt noch konkret nachgehalten wird, kann ich mir nur damit erklären, dass das für die Einkaufsorgien der Klassiker ein so großes Thema ist.
Hier wird als sechstes Prinzip noch die Technologie (Cyberware|Artificiality) angehängt, schon vom Layout her eine Marginalie. Dass Hutton das so komplett ausklammert und der jeweiligen Runde überlässt, finde ich wiederum gut.
Wer Technikphilosophie oder detaillierte-technische Ausstattungsoptionen sucht, hat genug Auswahl unter den diversen Cyberpunkrollenspielen. RT setzt andere Schwerpunkte:
1. Momentaufnahmen aus dem Leben der Figuren.
2. Somewhere als postmoderne Metropole.
3. Bewegen - aufeinander zu, aneinander vorbei, voneinander weg, ineinander, miteinander(?).
4. Zentrum und Peripherie.
Zum Schluss noch ein Wort zu den Illustrationen: Die sind im Innenteil leider Cyberpunk-Stockfotos. Dunkle Straßen und eine Menge Leute, die mit Waffen posieren. Wenig dynamisch und eigen im Vergleich zum Spiel.
/pic514946.jpg)

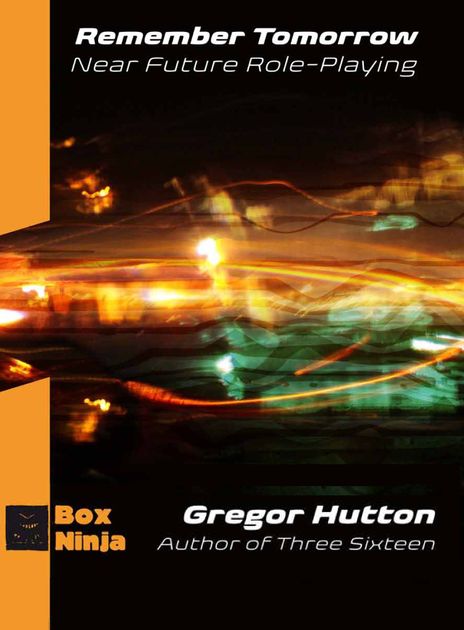




0 Yorumlar